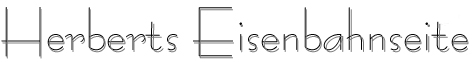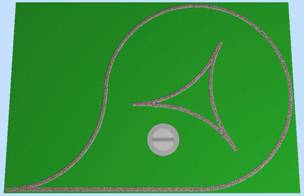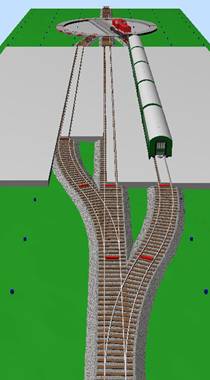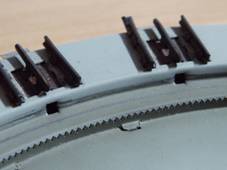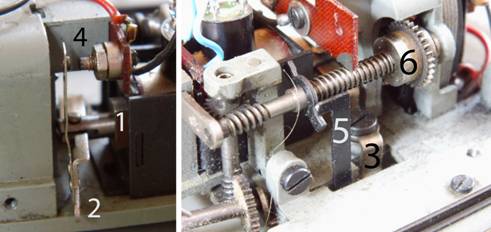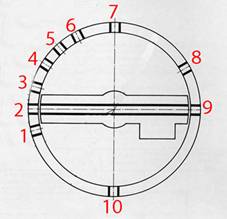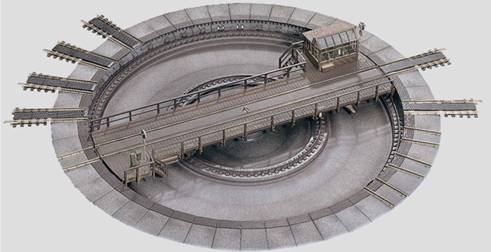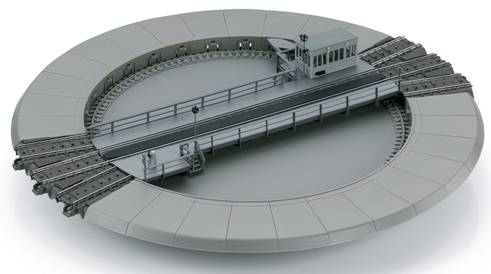|
|
|||||
|
Das
allererste Grundwissen über konventionell gesteuerte Märklin‑H0‑Modellbahnen
Rundherum
und hin und her – Die Märklin-H0-Drehscheiben und die ‑Schiebebühne |
|||||
|
Stand: 13.01.2026 14:47 |
|||||
|
Kontakt: Mail |
|||||
|
Historische
Grundlagen So
lange Dampfloks im Dienst waren, bestand insbesondere bei
Schlepptenderlokomotiven die betriebliche Notwendigkeit, die Lok zu wenden,
denn im Gegensatz zu den Tenderlokomotiven durften sie rückwärts, mit dem
Tender voraus, nicht so schnell fahren wie vorwärts. |
|||||
|
Das
Wenden war mit einer Wendeschleife möglich (sehr groß), einem Gleisdreieck
(ziemlich groß) oder eben mit einer Drehscheibe. |
|
||||
|
In
den ersten Bahnhöfen, die fast alle Kopfbahnhöfe waren, endeten die Bahnsteiggleise
oft an einer Drehscheibe, die dort eine baulich längere Weichenstraße
ersetzte und gleichzeitig das Drehen der Lok ermöglichte. Auch zu den
Wagenremisen führten die Gleise über Drehscheiben. Schnell
erkannte man, dass eine Drehscheibe ein sehr platzsparendes Mittel war, die
Loks auf Abstellgleise zu verteilen. Daher baute man dann die Lokschuppen
bogenförmig um eine Drehscheibe herum. Es
gab auch kleinere Drehscheiben in der Mitte von kuppelartigen Lokschuppen. Beispiele |
|
||||
|
Und
in Industrieanlagen gab es Waggon-Drehscheiben an Stellen, wo Waggons um die
Ecke gebracht werden mussten, aber kein Gleisbogen möglich war. Mit
dem Ende der Dampftraktion 1976 erübrigte sich der Unterhalt von
Drehscheiben; sie wurden an vielen Orten entfernt, manchmal aber auch sogar
mit einer Fahrdrahtspinne versehen und für E-Loks weiter-verwendet. Man
könnte meinen, bei europäischen Elektro- und Dieselloks spielt es keine
Rolle, in welcher Richtung sie fahren, da sie auf den ersten Blick oft
symmetrisch aufgebaut zu sein scheinen. Allerdings:
Drehscheiben
von Märklin Märklin
baute schon vom Anfang der Modellbahn-Produktion an Drehscheiben für die
verschiedenen Gleissysteme. Die
erste Drehscheibe, die für das M-Gleis-System kompatibel war, erschien 1939
im Katalog unter der Nummer 410M mit 3 Abstellgleisen und 3 Zufahrten. Eine
motorlose Ausführung dieser Drehscheibe trug die Nummer 410H. Die
im Folgenden genauer beschriebene Drehscheibe kam 1951 als Nr. 410N, später
7027, mit 6 Abstellgleisen und 4 Zufahrten. 1956
erschien eine Billigausführung davon mit 3 Abstellgleisen und 1 Zufahrt als
Nr. 410B, später 7026. 1991
erschien eine neue Drehscheibe mit flexibel ansetzbaren K-Gleis-Anschlüssen,
eine Variante einer Fleischmann-Drehscheibe. Und
2019 stellte Märklin eine neue C-Gleis-Drehscheibe vor. Die
„Tellermine“, die Drehscheibe für das M-Gleis |
|||||
|
Wir
betrachten als erstes das Baumuster ab 1951, das von Fans liebevoll
"Tellermine" genannt wird und in verschiedenen Farbgebungen noch
heute gebraucht in unterschiedlichen Erhaltungszuständen zu bekommen ist. |
|
||||
|
Varianten: mit
6 Abstellgleisen und 4 Zufahrten, mit roter Lampe auf dem Maschinenhaus von
1951 bis 1956: Nr. 410 N ab
1956: als "Super-Ausführung" bezeichnet nur
1957: Nr. 7027 mit
3 Abstellgleisen und 1 Zufahrt, ohne Lampe als
"Standard-Ausführung" bezeichnet nur
1956: Nr. 410 B nur
1957: Nr. 7026 mit
6 Abstellgleisen und 4 Zufahrten, ohne Lampe von
1958 bis 1993: Nr. 7186 Tipp
zu der Variante 410 B / 7026 Diese
Drehscheibe hat eine Zufahrt und gegenüber drei Schuppengleise. Das genügt,
um einen dreiständigen Schuppen zu bedienen und die Loks zu drehen. Eine
weitere, interessante Anwendung ist der kleine End-Kopfbahnhof mit drei
Gleisen (siehe Bild in der Einleitung). Geometrie
von Nr. 7186: Durchmesser
360 mm, Brücken(Schienen-)länge 308 mm, 14,8mm hoch (Schienenoberkante). Die
Drehscheibe hat M-Gleis-Anschlüsse, ist aber deutlich höher als das M-Gleis
mit 11 mm. Deshalb muss man entweder die Drehscheibe um 3,8 mm versenken oder
alle anschließenden Gleise unterfüttern. Die
Mittelleiter sind in Form einer dritten Schiene ausgeführt, als durchgehender
Mittelleiter. Für
die Beschreibung der besonderen Lage der Gleisanschlüsse empfehle ich, das Märklin-Buch 0700 auf Seite 7.2.014 zu
öffnen: Es
gibt 6 Schuppengleis-Anschlüsse in zwei Dreier-Gruppen. In
den Dreier-Gruppen haben die Gleise 15° Abstand, zwischen den Dreier-Gruppen
ist der Abstand um 2,5° größer, also 17,5°. Begründung:
Die
Drehscheibe besitzt neben den 6 Schuppengleis-Anschlüssen 4
Zufahrtsgleis-Anschlüsse. Mit
Hilfe von Übergangsgleisstücken, die es leider nur als gerades Gleisstück mit
180 mm Länge gibt, kann man die M-Gleis-Drehscheibe auch in K- und
C-Gleis-Anlagen verwenden: Übergangsgleisstück
M – C : ab 1999
Nr. 24951 Übergangsgleisstück
M – K : ab 1969 Nr. 2191, ab 1981 Nr. 2291 Hinweis
zum Übergangsgleisstück M – K: Auf
meiner Seite „H0-Gleisstücke mit Funktion“
zeige ich, warum diese Übergangsgleisstücke mit Bedacht eingebaut werden
sollten. Funktion: Zum
Download: Betriebsanleitung
der Drehscheibe 7186 An
der Schmalseite des Steuerpultes wird eine gelbe Leitung von der Licht-Buchse des Trafos angeschlossen. Links am Pult ist
dieser Anschluss ein Stecker, rechts eine Buchse. Diese beiden Anschlüsse
sind verbunden, also gleichwertig. Von
den drei Buchsen auf der Rückseite des Steuerpultes führen drei Leitungen zu
der Steckanschluss-Dreiergruppe an der Drehscheibe: Ø
rote Leitung: Spannung
für Drehen nach rechts, Ø
graue Leitung: Spannung
für Entriegeln, Ø
rote Leitung: Spannung
für Drehen nach links. Die
Masse bekommt die Drehscheibe über die angeschlossenen Gleise, zusätzlich
gibt es noch einen Masseanschluss mit etwas größerem Abstand neben der
genannten Dreiergruppe. |
|||||
|
Das
Steuerpult mit seinen zwei Knöpfen enthält einen Umschalter und zwei Taster. Wird
einer der beiden Knöpfe des Steuerpultes gedrückt, zieht ein Elektromagnet
die Verriegelung zurück und dann startet der Motor der Drehscheibe. Drückt
man den Knopf tiefer hinein, wird die Wippe des Umschalters ggf. in diese
Richtung gekippt und die Drehrichtung umgekehrt. |
|
||||
|
So
lange ein Knopf gegen die Federkraft gedrückt gehalten wird, bleibt der
Riegel der Brücke mit einem Elektromagnet aus der Rastöffnung zurückgezogen. |
|
||||
|
Wenn
man den Knopf loslässt, tritt der Riegel wieder bis an die Grubenwand vor und
rastet in die nächste vorbeikommende Rastöffnung ein, am nächsten
Gleisanschluss. Das
ist das Stoppsignal für den Motor. Will
man an einer Stopp-Position vorbeifahren, muss man den Richtungsknopf
rechtzeitig wieder drücken und bis nach der Vorbeifahrt halten. Wenn
man das Maschinenhaus abnimmt, kann man die Funktionen erkennen:
Der
Magnet (1) zieht den Handbedienhebel (2) an, der über Gestänge (3) mit dem
Brückenriegel verbunden ist. Am
Handhebel ist der Kontakt für den Fahrstrom (4), der dabei geschlossen wird.
Dieser Kontakt ist justierbar. Er muss geschlossen sein, wenn der Riegel an
der Grubenwand anliegt, und geöffnet, wenn der Riegel in einer Rastöffnung
ist. Nachdem
sich die Brücke in Bewegung gesetzt hat, kann der Handhebel nicht in seine
Grundstellung zurückkehren, weil der Riegel nicht in eine Rastöffnung am
Grubenrand eintauchen kann, sondern an der Wand der Grube schleift. Dadurch
bleibt der Kontakt für den Fahrstrom geschlossen, bis der Riegel in die
nächste Rastöffnung fällt. Wenn
das geschieht, öffnet der Fahrstrom-Kontakt und der Haken (5) stoppt das
Getriebe, während der Motor durch die Rutschkupplung (6) abgetrennt ausläuft. |
|||||
|
Die
elektrische Verbindung von Grube zu Brücke geschieht über fünf Schleifringe,
drei Schleifkontakte kann man auf der Brücke sehen. Die
Mittelleiter der sechs Schuppengleise sind abgeschaltet, so lange die Brücke nicht
davor steht. Die Mittelleiter der vier Zufahrtsgleise sind miteinander
verbunden. |
|
||||
|
Daraus
folgt, dass man das Zufahrtsgleis, das einem der Schuppengleise gegenüber
liegt, nicht uneingeschränkt benutzen kann, denn die abgestellte Lok gegenüber
würde mitfahren. Daraus
ergeben sich |
|||||
|
Die
Gleise 1 bis 6 sind die Abstellgleise, die Schuppengleise, die nur dann an
der Fahrspannung liegen, wenn die Brücke davor steht. Die
Mittelleiter der Gleisanschlüsse 7 bis 10 sind ab Werk verbunden. Wenn man an
den Gleisanschlüssen 7 bis 10 verschiedene Stromkreise hat, muss man die
Verbindungsleitungen unter der Drehscheibe trennen oder den Mittelleiter des
bereffenden Zufahrtsgleises am Drehscheibenrand isolieren. |
|
||||
|
Wenn
man über Gleis 9 eine Lok auf die Drehscheibe fährt, muss der Mittelleiter
von Gleis 2 gegen die Drehscheibe isoliert und separat versorgt sein, denn
die dort abgestellte Lok würde ebenfalls fahren, weil die Brücke davor steht. Die
Gleise 7 und 10 als Ein- und Ausfahrt hat den Vorteil, dass man die
Drehscheibe auch mit längeren Rangiereinheiten überfahren kann. Dasselbe gilt
für die Gleise 9 und 2, falls man Gleis 2 nicht als Abstellgleis nutzt. Wenn
man im Ringlokschuppen ein Werkstattgleis mit Grube plant, bietet sich Gleis
2 dafür an. Man kann dann über Gleis 9 die defekte Lok auf geradem Wege mit
einer Rangierlok in den Schuppen schieben. Wenn
man – wie ich – einen separaten Werkstattschuppen plant, dann sind die Gleise
7 und 10 aus demselben Grund dafür geeignet: z. B. Gleis 7 für den
Werkstattschuppen und Gleis 10 als Zufahrt. Eine
große Schlepptenderlok und eine Rangierlok passen nicht gleichzeitig auf die
Drehscheiben-Brücke. Deshalb ist der direkte Weg vorteilhaft. Übrigens
befindet sich beim Vorbild im Maschinenhaus einer Drehscheibe eine Seilwinde,
mit der fahruntüchtige Loks aus dem Schuppen oder über eine Umlenkrolle in
den Schuppen gezogen werden können. Wartung: Der
Motor ist baugleich mit den Scheibenkollektor-Motoren der Loks aus jener
Zeit. Daher
siehe meine Seite "Wartung - reinigen,
schmieren, ersetzen". Die
einwandfreie Funktion steht und fällt mit dem Zustand der Schleifringe und
der Schleifkontakte. |
|||||
|
Man
kann einfach die Drehbrücke abnehmen, wenn man an der Unterseite den
Sicherungsring an der Drehachse löst. |
|
||||
|
Damit
liegen die Schleifringe frei zum Reinigen. |
|
||||
|
Man
kann die Vorspannung, den Anpressdruck der drei Schleifkontakte einstellen,
verbessern. |
|||||
|
Dazu
habe ich eine kleine Büroklammer zurechtgebogen. |
|
||||
|
Mit
dem Haken fahre ich unter die Feder in Richtung des Befestigungsnietes.
Dadurch wird die Feder hochgezogen. Dann
drücke ich das abgewinkelte Ende der Feder mit dem Finger herunter, so dass
sie durch die Büroklammer einen leichten Knick bekommt. Nachdem
ich die Büroklammer entfernt habe, drücke ich die Feder wieder in ihre
ursprüngliche Position. |
|
||||
|
Nun
hat sie eine größere Vorspannung. Die
Schleifflächen reinige ich abschließend. Der
Zusammenbau dürfte kein Problem darstellen. Über
den Ersatz des Original-Steuerpultes und über Verbesserungen der Bedienung
und des Aussehens der Tellermine berichte ich HIER. Die
Fleischmann-Drehscheibe als Märklin-Version für das K-Gleis Da
ich selbst keine solche Drehscheibe besitze, muss ich mich auf zugetragene
Informationen beschränken.
Varianten: von
1991 bis 1993: Nr. 7686, digital gesteuert, konventionell befahrbar, von
1993 bis 2016: Nr. 7286, konventionell gesteuert, von
1994 bis 2016: Nr. 7687,
Digital-Nachrüst-Set dazu. Die
2-Leiter-Variante von Fleischmann soll angeblich auch für das Märklin-System
brauchbar sein, wenn man die Märklin-Gleisanschlüsse verwendet (ohne Gewähr). Übrigens:
Die gen Himmel ausgerichteten Fenster gab es erst, seit E-Loks auf der
Drehscheibe gedreht werden. Es ist notwendig, sicherzustellen, dass die
Stromabnehmer eingezogen sind, damit sie sich nicht in der Oberleitungsspinne
verfangen. Daher ist diese Drehscheibe erst ab Epoche 4 korrekt. – Man kann
allerdings das Maschinenhaus umbauen… Geometrie: Außendurchmesser
386 mm, Brückenlänge 310 mm. Im
Lieferumfang sind 6 K-Gleis-Anschlüsse, die beliebig im 7,5°-Abstand montiert
werden können. Daraus ergeben sich 48 mögliche Positionen. Weitere
Gleisanschlüsse im 3er-Satz: Nr. 7287. Mit
Hilfe von Übergangsgleisen, die es leider nur als gerades Gleisstück mit 180
mm Länge gibt, kann man die K-Gleis-Drehscheibe auch in M- und C-Gleis-Anlagen
verwenden: Übergangsgleis M – K : ab 1969
Nr. 2191, ab 1981 Nr. 2291 Übergangsgleis K – C
: ab 1999 Nr. 24922 Wegen
der Bauweise dieser Drehscheibe muss man eine Öffnung in den Tisch schneiden
und sie darin versenken. Dadurch liegen die abgehenden K-Gleise dann auf
Tischniveau. Bei M- oder C-Gleisen versenkt man sie weniger tief, so dass die
Schienenoberkanten passen. Funktion: |
|||||
|
Das
analoge Steuerpult erlaubt die Wahl der Drehrichtung und die Wahl zwischen
Einzelschritten und Dauerbetrieb. Die
Anleitung 7286 für konventionellen Betrieb |
|
||||
|
Die
neue Drehscheibe für das C-Gleis Da
ich diese Drehscheibe nicht besitze, beschränken sich meine Kenntnisse auf
die öffentlich zugänglichen.
Varianten: 2019
stellte Märklin eine neu konstruierte Drehscheibe vor unter der Nummer 74861. Seit 2021 lieferbar. Geometrie: Durchmeser
378 mm, Brückenlänge 263 mm. Raster
der möglichen Abgänge: 12°, daher nicht kompatibel zu den bisher erhältlichen
Ringlokschuppen. Passender
Märklin-Lokschuppen: Nr. 72886. Passender
Faller- Lokschuppen: Nr. 120281. Ausbaubar
bis zu 30 Abgänge mit dem Erweiterungssatz Nr. 74871. Wegen
der Bauweise dieser Drehscheibe muss man eine Öffnung in den Tisch schneiden
und sie darin versenken. Mit
Hilfe von Übergangsgleisen, die es leider nur als gerades Gleisstück mit 180
mm Länge gibt, kann man die C-Gleis-Drehscheibe auch in M- und
K-Gleis-Anlagen verwenden: Übergangsgleis K – C
: ab 1999 Nr. 24922 Übergangsgleis M – C
: ab 1999 Nr. 24951 Hinweis
zum Übergangsgleisstück K – C: Auf
meiner Seite „H0-Gleisstücke mit Funktion“
zeige ich, warum diese Übergangsgleisstücke mit Bedacht eingebaut werden sollten. Funktion: Ausschließlich
digital gesteuert, aber auch konventionell befahrbar. Die
M-Gleis-Schiebebühne Da
ich diese Schiebebühne nicht besitze, beschränken sich meine Kenntnisse auf
die öffentlich zugänglichen.
Varianten: ab
1979 bis 2011: Nr. 7294 ab
2012: 72941 Es
gibt dazu eine Oberleitungsgarnitur: Ab
2000 bis 2003: Nr. 7295 Geometrie: 360
x 420mm, M-Gleis-Anschlüsse, Höhe der Schienenoberkante wie die M-Gleise. Nur
zwei Anschlussgleise liegen sich gegenüber, im Bild die rechten. Die
spezielle Lage der Gleisanschlüsse siehe im Märklin-Buch 0700 Seite 7.2.015 Mit
Hilfe von Übergangsgleisen, die es leider nur als gerades Gleisstück mit 180
mm Länge gibt, kann man die M-Gleis-Schiebebühne auch in C- und
K-Gleis-Anlagen verwenden: Übergangsgleis M – C
: ab 1999 Nr. 24951 Übergangsgleis M – K : ab 1969
Nr. 2191, ab 1981 Nr. 2291 Hinweis
zum Übergangsgleisstück M – K: Auf
meiner Seite „H0-Gleisstücke mit Funktion“
zeige ich, warum diese Übergangsgleisstücke mit Bedacht eingebaut werden
sollten. Funktion:
Die
Anleitung 7294 |
|||||